Der Weg aus der Klimakrise, sozialer Ungerechtigkeit und dem Hunger in der Welt
(for an english version, please scroll down)
Die Polkappen schmelzen dahin, wir produzieren immer mehr Plastik und CO2, die Welt brennt lichterloh und trotzdem reden wir weiter den Klimawandel klein. Kein Wunder, dass unsere Kinder wütend sind. Immerhin: Ein Wandel in der öffentlichen Allgemeinheit ist zu erkennen. Ausgelöst von Jugendbewegungen wie Fridays For Future (FFF). Eltern beginnen sich endlich für eine neue Form von Umweltschutz zu interessieren. Klimalügen, wie fälschlich als “Bio“ plakatierte Produkte und Greenwashing betreibende Energiekonzerne werden entlarvt.
Aber warum ändert sich weiterhin nichts? Warum schnürt die Politik nur Alibipakete für die Klimarettung, anstatt sich des Ernsts der Lage bewusst zu werden? Die Antwort ist einfach. Die Wut der Klimademonstranten richtet sich gegen die Falschen. Was sollen Politiker schon machen? Sie sind auch nur Rädchen im System, in dem wir alle leben.
Kein klares Feindbild – keine Revolution
Die Sklaverei in den Vereinigten Staaten, der französische Hochadel, die Berliner Mauer – klare Feindbilder erleichtern es, die Massen für das Allgemeinwohl zu mobilisieren. Aber globale Klimapolitik? Ein derartig komplexes Thema versperrt sich einem grundlegenden Umsturz, weil es so schlecht greifbar ist. Gegen wen soll man bei globalen Problemen protestieren? Niemand ist schuld und doch irgendwie alle.
Es bringt jedenfalls nichts, sich einfach nur bei den Politikern zu beschweren, die unsere Interessen für uns vertreten sollen. Denn selbst dem gutgemeinten Ziel, wenigstens im eigenen Land ökologisch mit gutem Beispiel voranzugehen, stehen wie überall in der marktwirtschaftlichen Welt die Interessen des wirtschaftlichen Wettbewerbs und somit der Industrieunternehmen vor allen anderen. Solange deren Interessen einer grüneren Politik entgegenstehen, weil sich mit Dreck mehr Geld verdienen lässt, werden wir nie deutliche Veränderungen in Gang setzen!
Die treibende Kraft hinter der Profitgier
Soweit, so bekannt. Weitaus weniger bekannt ist dagegen, dass diese rücksichtslose und lebensverachtende Profitgier keineswegs aus dem kapitalistischen System selbst entspringt. Wenn dem so wäre, könnten wir wirklich nichts dagegen tun, ohne einen Systemsturz zu wagen und uns für ein sehr viel einfacheres Leben ohne iPhone und Krankenversicherung zu entscheiden. Aber tatsächlich treibt die Industrie der Industrienationen seit der Finanzkrise etwas viel Greifbareres an. Namentlich einzelne übermächtige Unternehmen, allen voran BlackRock. Sie haben noch nie davon gehört? Sollten sie aber!
Dieses New Yorker Unternehmen ist der größte Vermögensverwalter der Welt und verwaltet gut sieben Billionen US-Dollar (das ist eine 7 mit 12 Nullen). Geld, das Menschen in Pensionsfonds, Stiftungen und Kleinanlagen gesteckt haben. Es ist eine Schattenbank, wie es viele in der deregulierten Finanzbranche gibt, aber keine ist so mächtig wie der Marktführer BlackRock.
Die unsichtbare Macht hinter der Industrie
Mit diesem Geld, Geld das ihm gar nicht gehört, dass er nur für seine Kunden verwaltet, hat der Konzern in den vergangenen Jahren in mehr als 17.000 Unternehmen investiert und ist mittlerweile bei allen börsennotierten Weltkonzernen aus Europa und den USA einflussreicher Großaktionär. Facebook, Bayer, Monsanto, Exxon Mobil, Shell, BASF, RWE, Siemens, Deutsche Post, überall hat BlackRock seine Finger drin. Bei vielen bedeutenden Unternehmen wie Microsoft oder Apple ist BlackRock sogar Hauptaktionär.
Nicht Gates oder Zuckerberg geben mehr die Richtung in diesen Unternehmen an, sondern Larry Fink, der CEO von BlackRock. Der wiederum ist ein wahrer Meister der Untertreibung, wenn er seines weltweiten Einflusses auf ganze Branchen und Industriezweige betreffend gefragt wird. Und das obwohl er nachweislich immer wieder in seiner Funktion als Großaktionär Rundschreiben an alle Firmen schickt, an denen er Anteile besitzt, in denen er eindeutige Anweisungen gibt, in der Firmenpolitik keine sozialen oder ethischen Prinzipien vor das Gewinnstreben zu setzen.

Der Firmensitz von BlackRock in New York.
Fakt ist auch, dass sein Stimmrecht als Groß- oder gar Hauptaktionär in den meisten führenden Unternehmen in den USA und Europa eine noch nie da gewesene potenzielle Macht bedeutet. Diese Macht potenziert sich noch, bedenkt man die sensiblen Informationen, die BlackRock nach der Finanzkrise bei in seiner beratenden Tätigkeit gesammelt hat. Denn an wen hat sich die US-amerikanische Notenbank (Fed) oder die Europäische Zentralbank (EZB) nach der Krise gewendet? Richtig, BlackRock. Die Journalistin Heike Buchter kam im Handelsblatt aufgrund ihrer Recherchen zu dem Schluss: „Keine Regierung, keine Behörde hat einen so umfassenden und tiefen Einblick in die globale Finanz- und Firmenwelt wie BlackRock.“ Wen wundert es da also, dass kein Konzern- oder Staatschef in der westlichen Welt einen Termin mit Larry Fink zu verschieben wagt?
Werdet wütend!
Warum niemand etwas dagegen unternimmt? Weil dieser stille Riese bereits zu groß geworden ist. Trotz aller bisherigen Warnungen wagt bisher keine EU-Regierung, das drohende Kartell der Geldverwalter anzugehen. „Es untergräbt die Grundregeln unserer Marktwirtschaft, aber die meisten Politiker fürchten den Einfluss des Riesen und trauen sich nicht einmal kritische Fragen zu stellen“, beobachtete etwa der Bundestagsabgeordnete Michael Theurer. Andere Politiker wiederum, wie der ehemalige Kanzlerkandidat Friedrich Merz, stehen sogar schon auf der Gehaltsliste von BlackRock.
Warum, frage ich, lassen wir uns also von stumpfsinnigen Haien vorschreiben, wie unsere Gesellschaft zu funktionieren hat und nicht von empathischen Delfinen? Dagegen sollte sich unsere Wut richten!
Power to the people!
Letztlich bestimmen also den Kurs den wir alle gehen weder die Politiker einzelner Länder, noch die jeweilige Industrie eines Landes, sondern einzelne international agierende Geldverwalter wie insbesondere BlackRock, die den Unternehmen weltweit rücksichtslose Gewinnmaximierung vorschreiben und den irrsinnigen Traum des unendlichen Wirtschaftswachstums befeuern. Sie verkörpern die konservative Kraft, die uns, den Rücken zur Wand, dem Abgrund entgegen schiebt. Oder kurz gesagt: Geld regiert die Welt.
Was kann man dem entgegensetzen? Wut? Empörung? Mistgabeln? Morddrohungen? Nichts von alledem. Das einzige, das hier Wirkung zeigt, ist Geld. Wenn niemand mehr im Alter BlackRock und seinen hunderten Tochterfirmen seine Pensionen in den Rachen steckt und auch Millionen Kleinanleger ihr Geld nicht mehr sorglos solchen Risikomanagement-Unternehmen überlassen, können wir etwas verändern!
Wenn die Industrie die Politik bestimmt und mächtige Unternehmen wie BlackRock die wichtigsten Industriezweige entscheidend beeinflussen, müssen wir eben unser eigenes GreenRock gründen und uns die Industrie zurückkaufen! Wie das gehen soll? Ganz einfach! Nehmen wir allein eine FFF-Demonstration in Berlin, auf die sagen wir 200.000 Demonstranten gehen. Wenn etwa die Hälfte davon Erwachsene sind, die alle im Schnitt 10.000 Euro zurückgelegt haben, würden sie zusammen über ein Startkapital von einer Milliarde Euro verfügen. Schon mit einem Bruchteil davon ließe sich eine ähnlich mächtige Firma wie BlackRock gründen, die genau wie diese gigantische Vermögenswerte verwaltet, nur eben mit grünem Vorzeichen. Daran und an nichts sonst sollte uns etwas liegen: Anstatt vieler kleiner individueller Träume, sollten wir einen wirklich großen verwirklichen. Nur ein einziges Mal, würden wir dann nicht alle in den nächsten Urlaub, das nächste Auto oder das nächste Smartphone investieren, um uns von der Schlechtheit der Welt abzulenken, sondern gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten.
Internetphänomene wie “Wikipedia“ oder “Betterplace“ haben gezeigt, dass weltweit Menschen dazu bereit sind in etwas zu investieren, das der Gemeinschaft nützt. Und was bitte nützt der Menschheit mehr, als ein Planet auf dem man auch noch in 500 Jahren leben kann? Sind Sie wirklich bereit dazu, persönliche Abstriche zu machen, damit Ihre Kinder eine Zukunft haben? Dann fangen Sie endlich an zu handeln!
Vertrauen Sie nicht länger darauf, dass andere es schon für Sie richten werden und nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand! Nicht indem Sie sich darüber beschweren, was alles schiefläuft, sondern indem Sie das Problem bei der Wurzel packen! Gemeinsam können wir die Industrie zurückkaufen und ihr den Kopf umdrehen! Soziale Ungerechtigkeit und der Hunger in der Welt sind danach nur noch kleine Fische.
“Blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed.” – Bruce Springsteen
Weitergehende Literatur:
https://de.wikipedia.org/wiki/BlackRock
BlackRock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns. Eine Doku auf ARTE: https://www.youtube.com/watch?v=JR_UyV32Ba4
(english version)
Buy the industry!
The way out of the climate crisis, social injustice and hunger in the world
The polar ice melts away, we are producing more and more plastic and CO2, the world is burning brightly and still we continue to talk down climate change. No wonder our kids are angry. After all, at least a change in the general public can be seen. Triggered by youth movements like Fridays For Future (FFF). Parents are finally getting interested in a new form of environmental protection. Climate lies, as falsely labeled „organic“ products and greenwashed energy companies are exposed.
But why does nothing really change? Why are politicians putting together alibi packages for climate salvation, instead of being aware of the seriousness of the situation? The answer is simple. The rage of the climate protesters is directed against the wrong people. What should politicians do? They are also just a cog in the system in which we all live.
No clear enemy – no revolution
Slavery in the United States, the French aristocracy, the Berlin Wall – clear stereotypes make it easier to mobilize the masses for the common good. But global climate policy? Such a complex subject obstructs a fundamental upheaval because it is so hard to get a grasp on. Against whom should one protest at global problems? Nobody is to blame and yet somehow all.
At any rate, it does not do anything to complain simply to the politicians who are supposed to represent our interests for us. For even the well-intentioned goal of ecologically leading by example, at least in one’s own country, always has to stand behind the interests of economic competition, and thus of industrial enterprises, because all exist in a market-economy world and no one wants to get lost on the way. As long as their interests are opposed to a greener policy, because more money can be made with dirt, we will never be able to set any significant changes in motion.
The driving force behind the greed for profit
So far, so well-known. Far less well-known however, is that this ruthless and life-disdaining greed for profit does not arise from the capitalist system itself. If so, we really could not do anything about it without risking a system crash and opting for a much simpler life without iPhones and health insurances. But in fact, the industrialized nations are driven by something much simpler, especially since the last financial crisis. In particular, by individual overpowering companies like BlackRock. Never heard of it? But you should!
This company, based in New York, is the largest asset manager in the world and manages over $ 7 trillion (that’s a 7 with 12 zeros). Money, that people put into pension funds, foundations and small investments. It is a shadow bank, as many in the deregulated financial industry, but none is as powerful as the market leader BlackRock.
The invisible power behind the industry
With this money, money that does not belong to them, that they manage only for their customers, the group has invested in more than 17.000 companies in recent years and is now an influential major shareholder with all listed global companies from Europe and the United States. Facebook, Bayer, Monsanto, Exxon Mobil, Shell, BASF, RWE, Siemens, Deutsche Post, BlackRock has its fingers everywhere. BlackRock is even a major shareholder of many major companies such as Microsoft or Apple.
Not Gates or Zuckerberg are in the lead in these companies anymore, but Larry Fink, CEO of BlackRock. He, in turn, is a true master of understatement when asked about his global influence on whole industry sectors. And this despite the fact, that he repeatedly, in his function as a major shareholder, sends circulars to all companies in which he holds shares, giving them clear instructions to set no social or ethical principles in the company policy before the pursue of profit.

The headquarters of BlackRock in New York.
It is also true, that his right to vote as main- or at least the biggest single shareholder in most of the leading US and European companies means unprecedented potential power. This power is even more potent, considering the sensitive information that BlackRock has gained in its advisory role following the financial crisis. Who was addressed by the US Federal Reserve (Fed) or the European Central Bank (ECB) after the crisis? That’s right, BlackRock. The „Handelsblatt“-journalist Heike Buchter, on the basis of her research, came to the conclusion: „No government, no authority has such a comprehensive and deep insight into the global financial and corporate world as BlackRock.“ So it is no wonder, that there is no head of state or any corporate in the western world, dare to postpone an appointment with Larry Fink.
Get angry!
Why nobody does anything about it? Because this silent giant has already become way too big. Despite all the previous warnings of the media and politics, so far no EU government dares to tackle the impending cartel of the money managers. „It undermines the basic rules of our market economy, but most politicians fear the influence of the giant and do not even dare to ask critical questions,“ observed the german member of the House of Representatives Michael Theurer. Other politicians, like former german chancellor candidate Friedrich Merz, are even on BlackRock’s payroll.
Why, I ask, let stupid sharks dictate us to how our society works and not empathetic dolphins? On the this point, our anger should be directed!
Power to the people!
Ultimately, the course that we all go is determined neither by the politicians of individual countries, nor the respective companies of a country, but individual internationally acting money managers such as BlackRock in particular, which dictate the companies worldwide reckless profit maximization and fuel the insane dream of infinite economic growth. They embody the conservative power that pushes us, our backs to the wall, towards the abyss. In short, money rules the world.
What can one oppose to that? Anger? Indignation? Pitchforks? Death threats? None of these will help. The only thing that works here, is money. If senior citizen refuse to put their pensions in the mouths of BlackRock and its hundreds of subsidiaries and millions of retail investors no longer carelessly leave their money to such risk management companies, we can make a difference!
With industry dominating politics and powerful companies like BlackRock crucially influencing key industries, we need to start our own „GreenRock“ and buy back the industry! How to do that? Very easily! Take a FFF demonstration in Berlin alone: There alone are, say 200.000 protesters. If about half of them are adults, of whom everyone has laid aside an average of 10.000 euros, they would together have a start-up capital of one billion euros. Even with just a fraction of it, a similar company like BlackRock could be founded, which, like this one, manages gigantic assets, only under a green umbrella.
We should be interested in that and nothing else: Instead of many small individual dreams, we should realize one really big one. For once then, everyone wouldn’t invest in the next vacation, the next car or the next smartphone to distract themselves from the world’s badness, but would work together to create a better world.
Internet phenomena such as „Wikipedia“ or „Betterplace“ have shown us, that people around the world are willing to invest in something that benefits everyone. And what use does humanity benefit more, than a planet where you can still live in 500 years? Are you really ready to make personal sacrifices, so that your children have a future? Then start acting!
Stop trusting that others will fix it for you and take matters into your own hands! Not by complaining about what’s going wrong, but by tackling the problem at the root! Together we can buy back the industry and turn its head! Social injustice and hunger in the world, thereafter are only small fishes.
“Blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed.” – Bruce Springsteen









































































































































































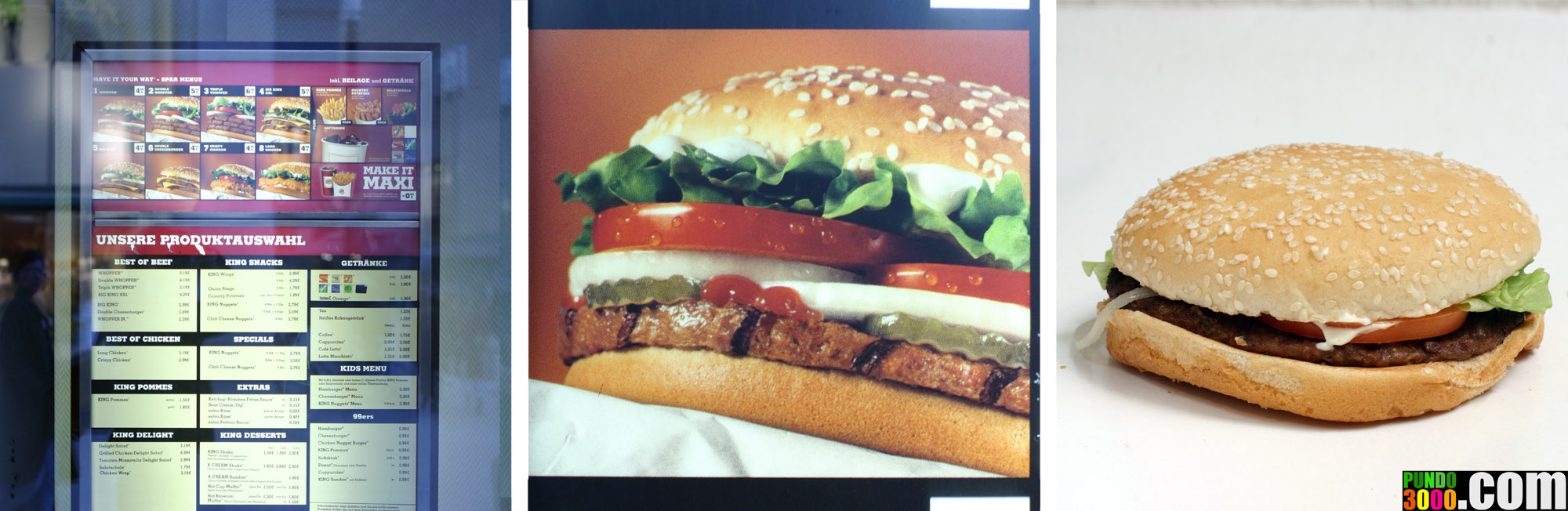




 Wie müssen wir uns richtig auf uns und die Welt beziehen, damit das menschliche Leben gelingen kann? Die Frage nach dem „guten Leben“ ist der Horizont, an den jede philosophische Überlegung im Grunde gerichtet ist. Immanuel Kants drei Grundfragen der Philosophie lauten: „Bei welcher Station muss ich aussteigen?“, „Warum bekomme ich dieses Wurstglas nicht auf?“ und: „Wie lange brauchen die Froschschenkel noch, Herr Ober?“ Oh, ach nein. Das waren ja meine drei Grundfragen an das Leben. Nein. Kant fragte vielmehr: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“ und: „Was darf ich hoffen?“ Eine Antwort blieb er uns schuldig. Oder, blieb er?
Wie müssen wir uns richtig auf uns und die Welt beziehen, damit das menschliche Leben gelingen kann? Die Frage nach dem „guten Leben“ ist der Horizont, an den jede philosophische Überlegung im Grunde gerichtet ist. Immanuel Kants drei Grundfragen der Philosophie lauten: „Bei welcher Station muss ich aussteigen?“, „Warum bekomme ich dieses Wurstglas nicht auf?“ und: „Wie lange brauchen die Froschschenkel noch, Herr Ober?“ Oh, ach nein. Das waren ja meine drei Grundfragen an das Leben. Nein. Kant fragte vielmehr: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“ und: „Was darf ich hoffen?“ Eine Antwort blieb er uns schuldig. Oder, blieb er?



























 Männerträume
Männerträume Brünhild ist nach jener Überlieferung die alleinige Herrscherin über ein gewaltiges Territorium: Sie erscheint als die mächtige Königin von Island, und immer wieder wird neben ihrer Schönheit, ihre physische Stärke hervorgehoben. Emanzipiert bestimmt sie selbst über ihr Leben und ihren Körper. Wer um sie freien möchte, muss sich zuerst mit ihr im Weitsprung, Speer- und Steinwurf messen. Jeder, der sie nicht besiegt, wird getötet. Sie bleibt ungeschlagen. Bis ein in sie vernarrter König namens Gunther sie herausfordert. Nur mit Hilfe des unter einer Tarnkappe verborgenen Helden Siegfrieds gelingt es ihm, mit der Frau mitzuhalten, die einen Stein schleudert, für dessen Herbeischaffung ein ganzes Dutzend Männer nötig waren. Selbst der Drachentöter Siegfried zollt dieser außergewöhnlichen Frau Respekt. Ihre Stärke wird unter den Männern als Bedrohung empfunden, denn der Gebrauch von Waffen kennzeichnet die dem Mann sozial zugewiesene Rolle. Eine bewaffnete Frau gilt im Mittelalter als mystisches Element. Wen verwundert es da, dass Brünhild eine Verbindung mit dem Teufel nachgesagt wird? Dies veranschaulicht die damalige, tief verwurzelte Angst vor der Wandlung der weiblichen Rolle in der Gesellschaft, die noch über Jahrhunderte hinweg vorherrschen sollte.
Brünhild ist nach jener Überlieferung die alleinige Herrscherin über ein gewaltiges Territorium: Sie erscheint als die mächtige Königin von Island, und immer wieder wird neben ihrer Schönheit, ihre physische Stärke hervorgehoben. Emanzipiert bestimmt sie selbst über ihr Leben und ihren Körper. Wer um sie freien möchte, muss sich zuerst mit ihr im Weitsprung, Speer- und Steinwurf messen. Jeder, der sie nicht besiegt, wird getötet. Sie bleibt ungeschlagen. Bis ein in sie vernarrter König namens Gunther sie herausfordert. Nur mit Hilfe des unter einer Tarnkappe verborgenen Helden Siegfrieds gelingt es ihm, mit der Frau mitzuhalten, die einen Stein schleudert, für dessen Herbeischaffung ein ganzes Dutzend Männer nötig waren. Selbst der Drachentöter Siegfried zollt dieser außergewöhnlichen Frau Respekt. Ihre Stärke wird unter den Männern als Bedrohung empfunden, denn der Gebrauch von Waffen kennzeichnet die dem Mann sozial zugewiesene Rolle. Eine bewaffnete Frau gilt im Mittelalter als mystisches Element. Wen verwundert es da, dass Brünhild eine Verbindung mit dem Teufel nachgesagt wird? Dies veranschaulicht die damalige, tief verwurzelte Angst vor der Wandlung der weiblichen Rolle in der Gesellschaft, die noch über Jahrhunderte hinweg vorherrschen sollte.